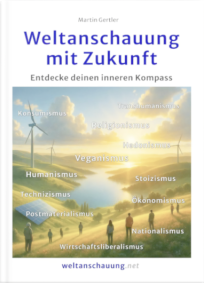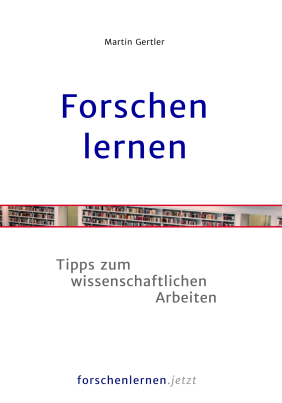Glossar der Schlüsselbegriffe
Checke dein Verständnis der im Buch verwendeten Begriffe und notiere dir spontane Ideen dazu!
- Abduktion: Ein Denkverfahren, das mit einer überraschenden Beobachtung beginnt und nach der plausibelsten Erklärung oder Hypothese sucht, die diese Beobachtung plausibel macht („Inferenz zum besten Schluss“).
- AI Disclosure Statement: Eine Erklärung im Methodenteil einer Arbeit, die
transparent darlegt, wofür generative KI-Tools eingesetzt wurden und wofür
nicht, um die wissenschaftliche Verantwortung des Autors zu verdeutlichen.
- Akademische Integrität: Die Einhaltung ethischer und intellektueller Standards in der wissenschaftlichen Arbeit, einschließlich Ehrlichkeit, Anerkennung fremder Leistungen und Transparenz.
- APA-Stil: Ein häufig verwendeter Zitierstil, insbesondere in den Sozialwissenschaften, der dem Autor-Jahr-System folgt.
- Bias (Voreingenommenheit): Eine systematische Verzerrung in der Forschung, die zu fehlerhaften Ergebnissen oder Schlussfolgerungen führen kann, z. B. Auswahlverzerrung oder Publication Bias.
- Boolesche Operatoren: Logische Verknüpfungen (AND, OR, NOT), die in Suchanfragen verwendet werden, um die Suchergebnisse zu präzisieren oder zu erweitern.
- Centauren-Modell: Ein Modell für das hybride Schreiben, bei dem der
Mensch der „Kopf“ (Strategie, Ethik) und die KI der „Körper“ (Textproduktion,
Masse) ist. Der Mensch komponiert Texte, anstatt jedes Wort selbst zu
schreiben.
- Deduktion: Ein Schlussfolgerungstyp, bei dem von einer allgemeinen Theorie oder Hypothese auf spezifische, überprüfbare Vorhersagen geschlossen wird, die dann empirisch getestet werden.
- Defensio: Die mündliche Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere einer Dissertation, vor einer Prüfungskommission.
- Demarkationsproblem: Die philosophische Frage, wie wissenschaftliche Theorien von nicht-wissenschaftlichen Theorien unterschieden werden können (zentral bei Karl Popper).
-
Dictation Prompting: Eine
Methode, bei der Gedanken zu einem Thema diktiert und anschließend von einer
KI in einen strukturierten, akademischen Text umgewandelt werden, um
Schreibblockaden zu überwinden.
- DOI (Digital Object Identifier): Ein dauerhafter Bezeichner für digitale Objekte, der eine stabile und langfristige Auffindbarkeit von Online-Publikationen gewährleistet.
- Empirische Forschung: Systematische Untersuchung der realen Welt durch Beobachtung, Experimente oder Befragungen, um Daten zu sammeln und Theorien zu testen oder zu entwickeln.
- Exposé: Ein schriftliches Konzept oder Projektvorschlag, der die Forschungsfrage, Ziele, den theoretischen Rahmen, die Methodik und den Zeitplan einer wissenschaftlichen Arbeit darlegt.
- Falsifizierbarkeit: Das Kriterium (nach Karl Popper), dass eine wissenschaftliche Theorie so formuliert sein muss, dass sie prinzipiell durch Beobachtungen oder Experimente widerlegt werden kann.
- Forschungsethik: Die moralischen Prinzipien und Standards, die das wissenschaftliche Forschen leiten, insbesondere im Umgang mit Studienteilnehmenden, Daten und der Veröffentlichung von Ergebnissen.
- Forschungstrichter (Research Funnel): Ein Konzept, das den Prozess visualisiert, wie ein weites Problemfeld schrittweise zu einer spezifischen und präzisen Forschungsfrage eingegrenzt wird.
- Grounded Theory: Eine qualitative Forschungsmethode, bei der Theorien systematisch aus den Daten selbst entwickelt werden, anstatt sie vorab festzulegen.
- HARKing (Hypothesizing After the Results are Known): Die Praxis, Hypothesen nachträglich zu formulieren, nachdem die Forschungsergebnisse bereits bekannt sind, was die Glaubwürdigkeit der Forschung untergraben kann.
- Heuristische Ansätze: Problemlösungsmethoden, die auf Erfahrung und intuitiven Regeln basieren, um zu einer brauchbaren, wenn auch nicht unbedingt optimalen Lösung zu gelangen.
-
Hybrides Forschen: Ein methodisch gesteuerter Prozess, in dem Forschende
ihre menschliche Urteilskraft (für Kontext, Ethik, Verifikation) und die
maschinelle Informationsverarbeitung (für Geschwindigkeit, Mustererkennung)
komplementär einsetzen.
- Impact-Faktor: Ein Maß für die durchschnittliche Zitationshäufigkeit von Artikeln in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, das jedoch kritisch hinterfragt wird, da es mehr über Popularität als über tatsächliche wissenschaftliche Qualität aussagen kann.
- Induktion: Ein Schlussfolgerungstyp, bei dem aus spezifischen Beobachtungen oder Einzelfällen auf allgemeine Gesetze oder Theorien geschlossen wird (explorativ).
- Informed Consent: Die freiwillige, auf vollständiger Aufklärung basierende Zustimmung von Studienteilnehmenden zur Teilnahme an einer Forschung, nachdem sie über Zweck, Risiken und Nutzen informiert wurden.
- Interdisziplinarität: Die Zusammenarbeit oder Integration von Ansätzen, Methoden und Theorien aus mindestens zwei verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, um eine komplexe Fragestellung zu bearbeiten.
- Iterativer Prozess: Ein wiederholender Zyklus in der Forschung oder im Schreiben, bei dem Schritte wie Planen, Ausführen, Überprüfen und Anpassen fortlaufend durchlaufen werden.
-
KI-Forschungssprint:
Ein straffer, in vier Phasen gegliederter Plan zur
Fertigstellung einer Dissertation, der durch Coaching und den intensiven
Einsatz von KI-Werkzeugen beschleunigt wird.
- Konfidenzintervalle: Ein Bereich um einen geschätzten Parameter (z. B. Mittelwert), in dem der wahre Wert des Parameters mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (z. B. 95 %) liegt.
- Konzeptualisierung: Die präzise Definition von Schlüsselbegriffen und theoretischen Konstrukten in einer Forschung, um deren Bedeutung und Anwendungsbereich klar festzulegen.
- Kritischer Rationalismus: Eine wissenschaftstheoretische Position von Karl Popper, die betont, dass wissenschaftliche Erkenntnisse stets vorläufig sind und durch Falsifikation überprüft werden müssen.
- Literaturmatrix: Eine systematische Tabelle zur Organisation und Übersicht von relevanten Forschungsliteratur, die Informationen wie Autor, Jahr, Forschungsfrage, Methoden, Ergebnisse und Limitationen enthält.
- Metaanalyse: Eine statistische Methode zur systematischen Zusammenfassung und Analyse der Ergebnisse mehrerer unabhängiger Studien zu einer bestimmten Forschungsfrage.
- Methodenpluralismus: Die Anerkennung und Nutzung einer Vielfalt von Forschungsmethoden (qualitativ, quantitativ, Mixed Methods) zur Untersuchung wissenschaftlicher Fragestellungen.
-
Methodentriangulation:
Die Kombination verschiedener Forschungsmethoden (z.
B. qualitative und quantitative), um ein Phänomen aus unterschiedlichen
Perspektiven zu beleuchten und die Robustheit der Ergebnisse zu stärken.
- Middle-Range Theories (nach Merton): Theorien, die spezifischer und empirisch besser überprüfbar sind als "Grand Theories", indem sie einen begrenzten Bereich sozialer Phänomene mit Konzepten verbinden.
- Mixed-Methods-Ansatz: Eine Forschungsmethode, die quantitative und qualitative Ansätze, Datenerhebungs- und Analysetechniken innerhalb einer einzigen Studie kombiniert, um ein umfassenderes Verständnis zu erzielen.
- Objektivität: Das Qualitätskriterium, dass wissenschaftliche Ergebnisse unabhängig von der forschenden Person oder dem Beobachter erzielt und interpretiert werden.
- Open Science: Eine Bewegung zur Förderung von Transparenz, Reproduzierbarkeit und Zugänglichkeit in der wissenschaftlichen Forschung durch offene Publikationen, offene Daten und offenen Code.
- Operationalisierung: Der Prozess, abstrakte Konzepte und theoretische Konstrukte in messbare Variablen oder Indikatoren zu überführen, die in einer empirischen Studie erhoben werden können.
- p-Hacking: Eine umstrittene Praxis in der Statistik, bei der Datenanalysen so lange angepasst oder variiert werden, bis ein statistisch signifikanter p-Wert (typischerweise p < 0.05) erreicht wird, was zu irreführenden Ergebnissen führen kann.
- p-Wert: Die Wahrscheinlichkeit, die beobachteten Daten (oder extremere Daten) zu erhalten, wenn die Nullhypothese wahr ist. Ein kleiner p-Wert (z. B. < 0.05) deutet auf Evidenz gegen die Nullhypothese hin.
-
P-Z-F-Prinzip:
Ein Prinzip zur Formulierung der Grundelemente einer
Arbeit: Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage,
die als roter Faden der Untersuchung dienen.
- Parsimonie (Sparsamkeit): Ein Prinzip in der Wissenschaft, das besagt, dass die einfachste Erklärung für ein Phänomen in der Regel die bevorzugte ist, sofern sie die Daten ausreichend erklärt.
- Peer-Review-Verfahren: Ein Prozess der Qualitätssicherung, bei dem wissenschaftliche Manuskripte vor der Veröffentlichung von unabhängigen Fachexperten begutachtet werden.
- Pomodoro-Technik: Eine Zeitmanagement-Methode, die feste Arbeitsintervalle (z. B. 25 Minuten) mit kurzen Pausen kombiniert, um Konzentration und Produktivität zu steigern.
- Power-Analyse: Eine statistische Methode zur Bestimmung der optimalen Stichprobengröße, die benötigt wird, um einen bestimmten Effekt mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (statistische Power) zu entdecken und Typ-II-Fehler zu minimieren.
- Prägnanz: Ein Merkmal des wissenschaftlichen Schreibens, das die effiziente Kommunikation von Ideen ohne überflüssige Worte oder redundante Informationen betont.
- Präregistrierung: Die öffentliche und zeitlich vor der Datenerhebung erfolgende Dokumentation des Forschungsdesigns, der Hypothesen und der geplanten Analysemethoden, um Transparenz und Reproduzierbarkeit zu fördern und Bias zu reduzieren.
- Primärquellen: Originale Forschungsartikel, Rohdaten oder Berichte, die direkte Evidenz oder erste Hand Informationen über ein Forschungsthema liefern.
- Publication Bias: Die Tendenz, dass Studien mit statistisch signifikanten oder positiven Ergebnissen eher veröffentlicht werden als Studien mit nicht-signifikanten oder negativen Ergebnissen, was zu einem verzerrten Bild des Forschungsstandes führen kann.
- Qualitative Datenanalyse: Die Identifizierung von Mustern, Themen und Bedeutungen in nicht-numerischen Daten wie Texten, Interviews oder Beobachtungen (z.B. Inhaltsanalyse, Grounded Theory).
- Quantitative Datenanalyse: Die Anwendung statistischer Methoden zur Analyse numerischer Daten, um Hypothesen zu testen, Beziehungen zu untersuchen und Verallgemeinerungen zu ziehen.
-
R-K-A-F-Prinzip: Eine Formel für effektive akademische Prompts,
bestehend aus Rolle, Kontext, Aufgabe und Format,
um die KI präzise zu steuern.
- Reliabilität: Das Qualitätskriterium, dass ein Messinstrument oder eine Methode konsistente und zuverlässige Ergebnisse liefert, wenn es unter denselben Bedingungen wiederholt angewendet wird (Zuverlässigkeit).
- Reproduzierbarkeit: Die Fähigkeit anderer Forschender, unter denselben Bedingungen und mit denselben Methoden ähnliche Ergebnisse einer Studie zu erzielen.
- Resilienz: Die Fähigkeit, mit Rückschlägen, Krisen und Stress umzugehen, sich anzupassen und gestärkt aus schwierigen Situationen hervorzugehen.
- Schneeball-System: Eine Recherchestrategie, bei der man ausgehend von einer relevanten Quelle sowohl deren Referenzliste (rückwärts) als auch die Zitationen dieser Quelle in späteren Veröffentlichungen (vorwärts) verfolgt.
- Sekundärquellen: Lehrbücher, Reviews oder Übersichtsartikel, die Primärquellen interpretieren, zusammenfassen oder analysieren. Sie sollten zur Orientierung genutzt, aber möglichst nicht direkt zitiert werden.
-
Semantische Suche:
Eine
KI-gestützte Suchmethode, die die Bedeutung einer Frage versteht und nach
konzeptionellen Antworten sucht anstatt nur nach exakten Stichwörtern.
- SMART-Kriterium: Ein Akronym zur Formulierung von Zielen: Spezifisch, Messbar, Achievable (erreichbar), Relevant, Terminiert (zeitlich festgelegt).
- Statistische Signifikanz: Ein Maß dafür, wie wahrscheinlich beobachtete Daten unter der Annahme sind, dass es keinen tatsächlichen Effekt oder Zusammenhang gibt (Nullhypothese). Ein Ergebnis ist statistisch signifikant, wenn es unwahrscheinlich ist, allein durch Zufall aufgetreten zu sein.
- Systematischer Review: Eine umfassende, transparente und reproduzierbare Methode zur Identifizierung, Auswahl, kritischen Bewertung und Synthese aller relevanten Forschung zum Stand eines Themas.
- Theoriebildung: Der kreative und logische Prozess der Entwicklung neuer oder der Weiterentwicklung bestehender Theorien auf der Grundlage von Beobachtungen, Daten und bestehendem Wissen.
-
Theorien mittlerer Reichweite:
(Middle-Range Theories) Theorien, die spezifischer und
empirisch besser überprüfbar sind als große, allumfassende Theorien (Grand
Theories) und eine Brücke zwischen empirischen Daten und abstrakten Konzepten
schlagen.
- Transdisziplinarität: Eine Forschungsform, die nicht nur verschiedene wissenschaftliche Disziplinen verbindet, sondern auch außerwissenschaftliches Wissen und die Perspektiven von Praxisakteuren oder Stakeholdern integriert, um gesellschaftliche Probleme zu lösen.
- Triangulation: Die Anwendung mehrerer Methoden, Datenquellen, Forschender oder Theorien in einer Studie, um die Robustheit und Glaubwürdigkeit der Ergebnisse zu erhöhen.
- Typ-I-Fehler (Alpha-Fehler): Der Fehler, eine wahre Nullhypothese fälschlicherweise abzulehnen (z.B. einen Effekt festzustellen, wo keiner ist).
- Typ-II-Fehler (Beta-Fehler): Der Fehler, eine falsche Nullhypothese fälschlicherweise nicht abzulehnen (z.B. einen tatsächlich vorhandenen Effekt nicht zu erkennen).
- Validität: Das Qualitätskriterium, dass ein Messinstrument oder eine Studie tatsächlich das misst oder untersucht, was es/sie messen oder untersuchen soll. Unterscheidung zwischen interner Validität (Kausalität in der Studie) und externer Validität (Generalisierbarkeit der Ergebnisse).
- Werturteilsfreiheit: Das wissenschaftliche Ideal, dass Forschungsergebnisse und -methoden nicht von persönlichen moralischen oder politischen Werturteilen beeinflusst werden sollten.
- Wissenschaftliche Redlichkeit: Ein umfassender Begriff für ethische und professionelle Standards in der Wissenschaft, der die Vermeidung von Plagiaten, Datenmanipulation, Interessenskonflikten und anderen Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens einschließt.
-
Zero Draft:
Ein sehr grober, erster Entwurf eines Textes, der oft
von einer KI generiert wird, um das „weiße Blatt“ zu überwinden und den
Überarbeitungsprozess zu starten.
- Zitiermanagementsoftware: Programme (z.B. Zotero, EndNote, Mendeley) zur Organisation von Literaturquellen, automatischen Erstellung von Zitaten im Text und Literaturverzeichnissen in verschiedenen Zitierstilen.

Mehr tun
Gezielte Angebote zur Vertiefung und zum Training:
0Noch keine Kommentare
Die Inhalte der Website
Promovieren mit Substanz: Start
Einführung sowie Video- und Audio-ElementeThemen und Ideen
Entdecke alle Anregungen und wichtige Formulierungen im Buch.Quiz zum Buch
Trainiere dich mit diesen kurzen Fragen und klaren Antworten.Essay-Aufgaben
Kurze Pause beim Umsetzen gefällig? Dann schreibe ein inhaltlich vertiefendes Essay zu Themen im Buch!Glossar der Schlüsselbegriffe
Was war nochmal „Bias“ oder „Parsimonie“? Hier kannst du schnell nachschlagen und deine Erinnerung auffrischen.FAQ
Wenn die Frage aufkommt: „Wie wird im Buch...“ und du schnell eine Antwort geben willst.Das Coaching-Modell
Einblicke in das vierphasige Coaching, das dir auf Grundlage dieses Buchs angeboten wird.Aktuelle Beiträge
Spannende und vielleicht wichtige Aspekte und Hintergründe
📖 Bildung und Training 📚
Tipps für 2026:
📱 Ebooks sind optimal – denn mit der kostenlosen Software Calibre kannst du sie ausdruckbar machen und die Inhalte erheblich einfacher weiterverarbeiten für dein wissenschaftliches Projekt! ... Siehe dazu auch meinen Blogbeitrag!

NEU: Trainingsbuch mit KI
2026. Weniger Vorträge, mehr Anwendungsübungen! Mit gründlicher Einführung in den neuen Ansatz des hybriden Forschens – endlich auch für Bachelor- und Masterstudierende gut umsetzbar. - Ca. 160 Seiten.
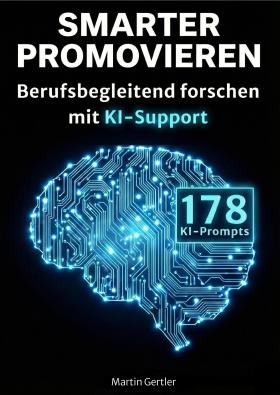
NEU: Dissertation mit KI
2026. Das neue hybride Forschen mit KI nun auch für die Forschung auf Doktoratsniveau! Viele Übungsaufgaben und zahlreiche Prompts zur direkten Umsetzung. Der Promotionsbegleiter bis zum Schluss! - 280 Seiten.
Erscheint in wenigen Tagen!

NEW: Ways of thinking
2025. They seem to determine our everyday lives and also politics. They are also the basis for our willingness to adapt to the climate crisis and change our behavior. - Dissertation in Social Science. 262 pages.
promovieren.net ist ein Angebot von Prof. Martin Gertler, PhD ©2025 - 2026